
Die Geschichte im Filter des 19 Jh.
Wir sehen unsere Geschichte immer durch den Filter des 19. Jahrhunderts
Diese Behauptung soll erklärt werden:
WIR – das sind wir Nachgeborenen, die wir von der Renaissance oder Napoleon durch viele Generationen getrennt sind und keine wirkliche Erfahrung von jenen Vorgängen haben. Wir sind die Gebildeten des 21. Jahrhunderts, Akademiker wie auch Arbeiter, ja die lesenden Arbeiter auch: sie sehen Geschichte durch die Brille von Marx und Engels.
SEHEN – das meint: verstehen, weitergeben, beurteilen, benützen und glauben.
UNSERE – das ist unsere eigene, was die Sicht auf die Geschichte anderer Völker nicht ausschließt, denn die gehört genauso zu uns.
GESCHICHTE – bedeutet nicht das, was geschehen ist, sondern das, was darüber mitgeteilt wird, genauer also: Geschichtsschreibung.
IMMER heißt hier: es geht nicht anders, es ist vorprogrammiert.
FILTER ist ein Ausschließungsverfahren, ein Auswahlvorgang, eine Vorbeurteilung.
19. JAHRHUNDERT bedeutet hier den Zeitraum von 1815 bis 1914, also die hundert Jahre vor dem 1. Weltkrieg.
Was bedeutet nun dieser Satz insgesamt?
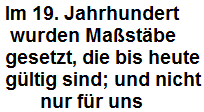 Im 19. Jahrhundert wurden Maßstäbe gesetzt, die bis heute gültig sind. Nicht nur für uns, aber das vor allem.
Im 19. Jahrhundert wurden Maßstäbe gesetzt, die bis heute gültig sind. Nicht nur für uns, aber das vor allem.
Beispiel: Jemand möchte wissen, was Zoroaster (Zarathustra) in Persien vor Jahrtausenden gelehrt hat. Er schlägt in Büchern nach (oder in google oder in wiki) und erhält das Wissen, das im 19. Jh. erarbeitet wurde zu diesem Thema. Im Internet kann nichts anderes stehen als in den Büchern, denn im Netz wird in Sachen alter Geschichte noch nicht neu geforscht, sondern das vorhandene Wissen gebündelt und wiedergekaut.
Wenn das Wissen unserer Urgroßväter in Sachen Zoroaster in unserem Jahrhundert vervollkommnet wurde, dann auf derselben Grundlage, ohne ernste Kritik der Vorgaben oder Neubeginn. Das kann jeder Student bestätigen. Auch wenn wir heute besser Persisch können als jene Gelehrten. Aber ein Rückgriff auf die Kenntnisse der Parsen in Bombay bringt keine Verbesserung, denn auch diese gründen sich – außer auf ihre Folklore – auf die Forschungsergebnisse der Europäer.
Das Schema ist an dieser Stelle nachprüfbar, am Streit der Parsen in Indien: Ein friedliches Volk zerfleischt sich in blutigen Kämpfen, weil die Zeitrechnung durch die Geschichtsschreibung durcheinander gebracht wurde (siehe Uwe Topper: Erfundene Geschichte 1999, S. 119-122).
Die Anhänger Zarathustras im Iran haben, wie man sich denken kann, nicht in geschlossener Gemeinschaft den Islam übernommen, sondern sich heftig gewehrt und nach der Niederlage in Scharen die Flucht ergriffen, wie ihre eigenen Chroniken berichten. Zwar haben in abgelegenen Gebieten wie Yäsd und Kermanschah einige Gemeinden bis heute (zumindest bis 1961, als ich dort war) überlebt, aber insgesamt war die Bekehrung oder Vertreibung doch erfolgreich. Die Parsen von Bombay sind die größte Exilgemeinde der vertriebenen Zoroastrier, und ihre Überlieferungen könnten weiteres Licht auf die damaligen Vorgänge werfen.
Ihre Chroniken oder Epen, wie das Kissa-e-Sendschan, sind erst nach 1600 verfaßt, sie beruhen vermutlich teilweise auf älterer mündlicher Tradition. Dennoch ist daraus keine chronologische Gewißheit zu erlangen, denn es gibt auch hier einen Sprung über drei Jahrhunderte, in denen weder Priester noch Könige genannt werden.
Die parsischen Flüchtlinge rechneten von der Thronbesteigung ihres letzten Königs Yäsdegird (III) weiter, weil niemand nach ihm mehr den Pfauenthron bestieg, und schrieben etwa das Jahr 600, als die Portugiesen bald nach 1500 den Hafen Bombahia (= die gute Bucht, Bombay) gründeten und mit den Parsen Kontakt aufnahmen. Auf dem portugiesischen Zeitstrahl waren seit dem Aufstieg des Islam und der damit verbundenen Vertreibung der Parsen aus dem Iran schon 900 Jahre vergangen, entsprechend ihrer Kirchengeschichte. Um 1600 schrieb nun ein gelehrter Parse das Kissa-e-Sendschan, die Chronik der Parsen in Indien, und fügte – um den neuen Erkenntnissen der überlegenen portugiesischen Siedler gerecht zu werden – die fehlenden 300 Jahre zwischen ihrer Vertreibung aus dem Iran und der Verteidigung gegen Mahmud von Ghazni in die Geschichte ein. Die drei Jahrhunderte blieben zwar ohne jegliche Angaben (das Erfinden von Sagengestalten war wohl nicht Angelegenheit dieses Chronisten), verzerrten aber das Gesamtbild, um es der europäischen Geschichtsschreibung anzugleichen.
Das Problem der Datierung der Parsenflucht wird in allen heutigen Nachschlagewerken sichtbar. Einerseits rücken in den lapidaren Zusammenfassungen der Lexika die islamischen Heere im 7. Jahrhundert gegen die persischen Feueranbeter vor. Andererseits erfolgt die Massenflucht der Parsen erst im 10. Jahrhundert (wie z.B. im Brockhaus 1972). Das kommt wohl daher, daß man im ersten Satz islamische, im zweiten parsische Quellen zugrundelegt. Hier ist die Verschiebung der beiden Zeitskalen gegeneinander offensichtlich.
Den Parsen ist dieser Widerspruch natürlich selbst zuerst aufgefallen. Da sie im 18. Jahrhundert unter dem politischen Schutz der Engländer als ‚europide Rasse‘ in Indien bald zu Ansehen und Einfluß gelangten, knüpften sie selbstbewußt Kontakte mit den im Iran verbliebenen Glaubensgenossen, die trotz jahrhundertelanger grausamer Unterdrückung noch überlebten, und baten um Priester zur Unterweisung in der rechten Lehre. Zweimal, so wird berichtet, in den Jahren 1721 und 1736, kamen Mobeds (Lehrer) aus dem Iran nach Indien. Dabei trat etwas Unerwartetes zutage: Die Zeitrechnung der beiden Gruppen, der iranischen und der indischen Zoroastrier, stimmte nicht überein. Die Feste fielen auf verschiedene Tage. Angeblich habe der Unterschied einen Monat betragen, aber was damit tatsächlich ausgesagt wird, ist unklar. (Zum Vergleich: Der Unterschied zwischen Julianischem und Gregorianischem Kalender und damit der Feste beträgt zur Zeit zwei Wochen).
Der Streit war grundsätzlicher Art und unüberbrückbar. Die indischen Parsen hätten nämlich alle Daten der früheren Zeit von den Sassanidenkönigen an, deren Ära man angeblich sorgfältig weitergeführt hatte, völlig neu schreiben müssen. Es bildeten sich nun zwei Gruppen unter den indischen Parsen, die Schahinschahis (Königlichen) und die Kadimis (Altgläubigen). Die einen übernahmen die neue Kalenderform von den Sendboten aus dem Iran, die anderen beharrten auf ihrer alten Datierungsweise, die sie selbst nach Indien mitgebracht hatten. Jahrzehntelang tobten blutige Kämpfe zwischen beiden Parteien, bis man 1783 in der Stadt Broach einen Kompromiß schloß, der das Thema schlicht unter den Teppich fegte. Seitdem bestehen beide ‚Sekten‘ nebeneinander. Mischehen kommen kaum vor, aber Kämpfe auch nicht mehr.
Die Encyclopedia Britannica (1911) sagt unter dem Stichwort Parses über die beiden Sekten: „Sie unterscheiden sich in keinem einzigen Glaubenspunkt; der Disput beschränkt sich auf den Streit um das korrekte chronologische Datum für die Berechnung der Ära Yäsdegirds, des letzten Königs der Sassaniden-Dynastie.“
Auffällig bleibt, daß ein so friedfertiges Volk um dieses Problem fast zwei Generationen lang Blut vergossen hat. Es muß hier um etwas Grundsätzliches gehen, das alle Vernunft übersteigt: um die Identität, die durch geglaubte Geschichtsschreibung begründet wird.
Weitere Beispiele für die Übernahme fremder Jahreszählungen können zuhauf gebracht werden, besonders auffällig liegt der Fall in China, für das ich auf Uwe Toppers Buch verweise (Die große Aktion 1998). Man glaubt dort heute felsenfest, daß die von den Jesuiten ab Ende des 16. Jahrhunderts hergestellte Chronologie chinesisch sei.
Die Abhängigkeit von der europäischen Gelehrsamkeit ist auch in näheren Bereichen feststellbar. Wenn islamische Gelehrte ein Argument besonders bekräftigen wollen, zitieren sie aus der Enzyklopädie des Islam, am besten der originalen deutschen Ausgabe. Die Nahda (Wiedererwachen des Islam seit Ende des 19. Jh.s) stützte sich mit Vorliebe auf die Arbeiten deutscher und französischer Theologen, meist Christen und Juden, denn deren Ausgaben islamischer Werke sind noch heute vorbildlich und Grundlage aller weiteren Forschung.
Das trifft auch auf andere Religionsgruppen zu, etwa die Brahmanen in Indien, wenn auch nicht so ausgeprägt. Ihre heiligen Schriften wurden von den Eroberern in allerbester Weise herausgegeben, und diese dienen Indern wie Europäern noch heute als Maßstab.
Es gibt auch Volksgruppen, die durch politischen Druck fast von ihrer Vergangenheit abgeschnitten wurden – etwa Tibeter, Jesiden, Berber – und heute dank der wissenschaftlichen Arbeiten europäischer Ethnologen ihre Identität wiederfinden. Das ist erfreulich für sie. Es bedeutet für uns aber, daß das, was wir über die fast verlorenen Minderheiten erfahren können, aus unserem eigenen Schatz stammt. Und der war begrenzt. Nicht nur hinsichtlich der Menge und Vielfalt der Erkenntnisse, das sowieso, sondern auch in Bezug auf die Sicht: Eingeschränkt durch die religiösen und kulturellen Vorurteile, die nun einmal auch in dem so aufgeklärten 19. Jh. herrschten, ist unser Blick auf die Geschichte – die eigene oder die anderer Völker – begrenzt und gefiltert.
Das ist mit obigem Satz ausgesagt.
Was bedeutet das für uns heute?
Die neu entstehenden oder wieder erwachenden Völker definieren sich über ihre vermeintliche Geschichte. Ob es eine andere Möglichkeit gäbe, möchten wir hier nicht erörtern. Ein paar Beispiele sollen erläutern, was gerade geschieht. Die kurdische Nationbildung greift auf die ruhmreiche Vergangenheit einzelner kurdischer Dynastien und Stämme zurück, sie schafft sich eine eigene Schriftsprache mit Wertbegriffen aus der Geschichte, einer Geschichte, die andere geschrieben haben, vor allem die europäischen Geographen und Ethnologen des 19. Jhs.
Noch deutlicher zeigt uns das die neugefundene staatliche Ideologie Tadschikistans, ein Land das sich seit 2006 als „arisch” darstellt. Damals rief der Präsident, Emomalii Rahmon, das offizielle „Jahr des Ariertums” aus, und seitdem ist auch die Swastika ein häufig verwendetes Staatssymbol geworden. Die Gleichsetzung „Tadschiken – Arier” basierte auf den Theorien mehrerer tadschikischer Geschichtswissenschaftler, die die persisch sprechenden Tadschiken als „Urvolk” Zentralasiens ansehen, und anprangern, daß aus dem mongolischen Raume eingewanderte Turkvölker (vor allem Uzbeken, aber auch Turkmenen, Kirgizen, Kasachen usf.) ihnen den größten Teil ihrer eigentlichen historischen Heimat entrissen hätten.
Rahmon griff diese Ideen in seinem Werk „Die Tadschiken im Spiegel der Geschichte: Von den Ariern zu den Samaniden” (London, 2000; deutsch 2011) auf und machte sie schließlich zum Fundament seiner Staatsideologie. Hier paart sich zum geschichtlichen Vorrat, der nur auf den gut gedüngten Böden europäischer Universitäten seit 150 Jahren gewachsen ist, noch ein weiterer Machtfaktor: der rassische in Gestalt des Ariertums.
Wenn man auch hervorheben muß, daß das Wort Arier aus jenen persischen Ländern stammt, in denen es heute wieder zur Blüte kommt, so ist doch grundlegend zu betonen, daß es erst durch die europäische Forschung, vor allem die Schöpfer der vermeintlich re-konstruierten indogermanischen Ursprache (Bopp, Grimm u.a.), von den Tadschiken aufgegriffen werden konnte.
Im Deutschen war „race“ (man schrieb es so) noch lange ein Fremdwort. Es war der Begriff einiger Franzosen in ihrer Revolution (1789) zur Anklage gegen das ‚germanische‘ Königshaus durch das gallische (keltische) Volk. Es wurde dann von Engländern zwecks Abgrenzung von den unterworfenen Kolonialvölkern zu wissenschaftlicher Blüte gebracht und ist heute Bestandteil jener Bewegungen, die sich von der arabischen Religion, die als fremd empfunden wird, lossagen wollen.
In dieser tadschikischen Arier-Bewegung wird nun ein sprachlicher Begriff zur politischen Formel erhoben, der zur Abgrenzung gegen die fremden Völker im Umkreis, Mongolen und Türken, aufruft, und zugleich eine Verwandtschaft mit den Slawen heraufbeschwört, also hier mit den Russen, die als Befreier vom Tatarenjoch gefeiert und wegen ihrer laizistischen Einstellung zu Vorbildern wurden. Die vorgebrachten Argumente, soviel ist für unsere Betrachtung nur wichtig, stammen alle aus der Küche der europäischen Akademien, wo sie zunächst keine politische Funktion hatten, sondern unter dem Schutz der staatlichen Wissenschaft Ansehen genossen und weltweit zur Grundlage der Kulturvölker erhoben wurden.
Nach Einführung dieser offiziellen akademisch-europäisch erarbeiteten Sicht wird nun nicht mehr feststellbar sein, inwieweit die Tadschiken sich traditionell selbst als Arier verstanden (im Sanskrit: Adlige, in Altpersien eine Volksgruppe, ihr Land heißt Iran), was genau sie sich unter diesem Begriff vorstellten, wie verbreitet das Swastika-Symbol in ihrer Volkskunst war und welche Gedankenwelt damit verbunden war.
Was ganz besonders auffällt an dieser Entwicklung ist die Verwendung von geschichtlichen Jahreszahlen und Zeitvorstellungen, die kritiklos aus Europa übernommen werden und aus den eigenen Überlieferungen auch nicht hinterfragt werden können, da diese grundsätzlich achronistisch sind. Dabei entstehen so seltsame Blüten wie die berberische Jahreszählung, die erst vor etwa zwanzig Jahren aufkam und ihren Vorteil zur Schau trägt: Sie reicht um mehr als 900 Jahre weiter zurück als die christliche Zählung.
Genau dies ist das traurige Nachspiel bei den Berbern Nordafrikas, deren kulturelle Bewegung in den letzen zwei Jahrzehnten erwacht ist: die Verwendung der Sheshonq-Ära. Wir schreiben jetzt (2012 AD) berberisch das Jahr 2962 seit der Thronbesteigung des ägyptischen Pharaos Scheschonk. Diese eigenartige Zählweise ist in den 1990er Jahren aufgekommen. Irgendjemand hat geglaubt, zum echten julianischen Kalender, der seit römischen Zeiten in Nordafrika unverändert verwendet wird, mit seiner entsprechenden traditionellen Neujahrfeier am 14. Januar, gregorianisch sein müßte und auch eine passende Jahreszahl haben müßte. Darum hat man — angeblich schon in den sechziger Jahren in der Berberakademie von Paris, laut der französischen Wikipedia-Enzyklopädie) — den Pharao Sheshonq aus der 22. Dynastie Âgyptens genommen, der 950 v. Ztr. (nach europäischer Chronologie) den Thron bestiegen habe und angeblich libyschen Ursprungs gewesen sei, somit berberischer Herkunft. Die kulturellen Amazigh-Bewegungen nehmen als Jahresanfang meist den 13. Januar, wie er in der algerischen Kabylei im 19. Jh zuletzt fixiert wurde, obwohl dies heute nicht mehr übereinstimmt mit dem korrekten Julianischen Kalender, wie er in Marokko alltäglich verwendet wird.
Scheschonk ist ein ziemlich bekannter ägyptischer König: Er heißt in der Bibel Sisak (sonst auch Sesonchis), stammte aus Bubastis und gilt als der Böse, weil er Jerobeam, der vor Salomon floh (1. Kön. 11, 40) Asyl gewährte und später Rehabeam in dessen 5. Regierungsjahr in Jerusalem überfiel und die Palast- und Tempelschätze raubte (1. Kön. 14, 25 u. 26), wie auch auf der Südwand im Tempel von Karnak dargestellt ist.
Da die ägyptische Chronologie immer jünger wird, läßt sich eines Tages leicht erkennen, wann die Berber ihr Datum übernommen haben. Um 1885 (Meyers Lexikon) fand Sisaks Thronbesteigung elf Jahre eher statt, 961 v.Chr., in der Lutherbibel (Ausgabe 1963) dürfte es gegen 932 v.Chr. gewesen sein. Paris ist mit 950 v.Chr. etwas altmodisch. Moderne Chronologien haben meist ein viel jüngeres Datum. Wie man sieht, gründet die Festlegung auf ein genaues Anfangsjahr auf die unbedachte Übernahme der akademischen Jahreszählung europäischer Prägung. Selbst wenn der Erfinder der neuen berberischen Zeitrechnung von seiner Großmutter den Namen eines mythischen Königs „Ascheschuneg“ (oder so ähnlich, von mir erfunden) gehört haben sollte, was zu bezweifeln ist, hat es dazu ganz sicher keine Jahreszahl gegeben, und schon gar nicht diese, denn es gibt unter Berbern keine eigene, tradierte Zeitrechnung, und Angaben über Geschichte, wenn sie eigener Tradition entspringen, werden lose in Jahrhunderten gemacht. Mehr als drei bis vierhundert Jahre zurück reicht ihre Erinnerung nicht.
Diese europäisch fixierte akademische Zeitrechnung nun gleichzeitig mit dem echten tradierten julianischen Kalender zu verwenden, ist eigentlich schon nicht mehr Identitätsfindung sondern -Identitätserfindung.

